Raum nach oben
Auch wenn die etablierten Taxifirmen Sturm laufen: Mittels Uber gelangen immer mehr Menschen günstig von A nach B. Dahinter liegt eine ambitionierte gesellschaftspolitische Agenda. CEO Andreas Weinberger erklärt im Interview wie die Zusammenarbeit mit Rot-Grün in Wien klappt und wie sich Unternehmen vor Disruptionen schützen.


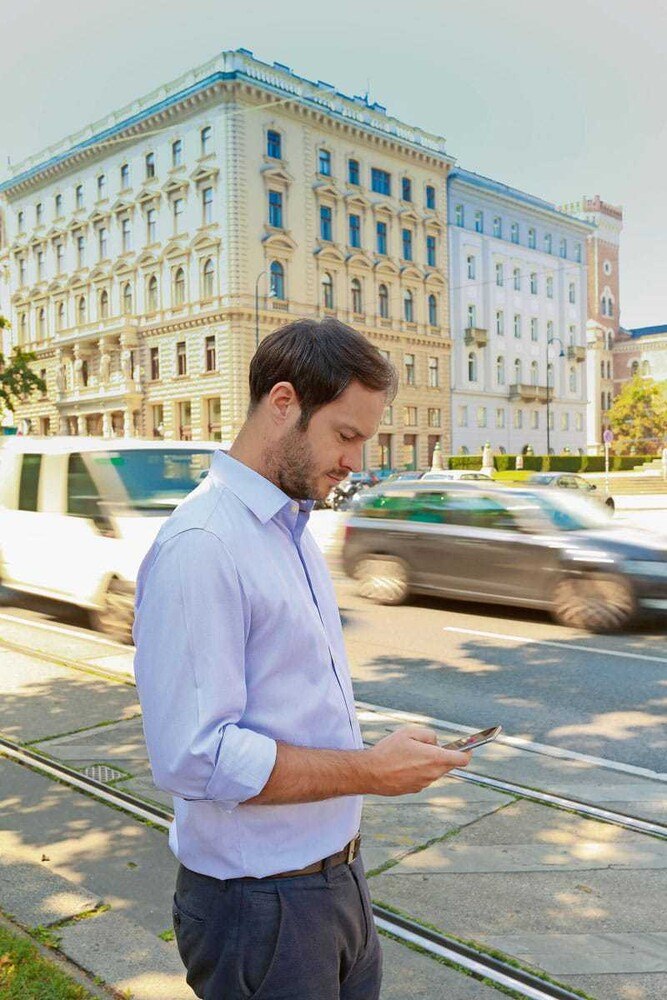
Uber gilt heute als Paradebeispiel für Disruption. Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
Uber ist eine App, mit der man sich per Knopfdruck ein Fahrzeug bestellen kann. Sie soll den Menschen dabei helfen, einfach, günstig und flexibel von A nach B zu kommen. Darum geht es.
Das machen Taxiunternehmer allerdings schon immer, und Apps stehen ihnen auch zur Verfügung. Uber hat trotzdem jede Menge Staub aufgewirbelt. Was ist so anders?
Uns unterscheiden mehrere Aspekte: die Einfachheit, der günstige Preis und die weltweite Verfügbarkeit – Sie benötigen nur eine App für 450 Städte in 70 Ländern. Ein wesentlicher Punkt ist auch die Transparenz. Man sieht immer, welcher lizenzierte Fahrer einen abholt, die ideale Route wird dem Fahrer vorgegeben und der Fahrpreis bargeldlos im Hintergrund abgerechnet, kein Warten auf das Wechselgeld, kein hin und her Überlegen wegen Trinkgeld. Man kann seine Strecke auch mit anderen zum Beispiel über WhatsApp teilen. So sehen Freunde, wo man gerade ist und wann man ankommt.
Uber hat mit diesem Ansatz viele Kunden gewonnen und gleichzeitig von der alteingesessenen Taxiwirtschaft enormen Gegenwind geerntet. Woran liegt das?
Wir haben über bezahlbare Preise neue Nachfrage geschaffen. Und unsere Technologie hat uns dabei geholfen, diese Nachfrage auch in reale Fahrten umzusetzen. Hier liegt der Knackpunkt. Wir bringen immer dasjenige Fahrzeug mit dem Kunden zusammen, das am schnellsten dort sein kann. Das sind Effizienzsteigerungen, die nur dank der Digitalisierung möglich sind.
Kosteneffizienz und Service sind allerdings Themen, die Uber nicht neu erfunden hat. Uber hat aber etwas getan, dass für viele schwer zu akzeptieren war: Ein Taxiunternehmen gegründet, ohne ein einziges Taxi zu besitzen.
Uber ist kein Taxiunternehmen. Uber bietet einen digitalen Marktplatz und bringt damit Effizienzsteigerungen in einen Bereich, der die letzten 40 Jahre keine echten Innovationen hervorgebracht hat. Von dieser zusätzlichen Effizienz profitieren alle. Der Kunde durch einen günstigeren Preis und mehr Service. Der Fahrer profitiert von mehr Kunden. Und: Durch Uber werden Touristen mobiler in Wien, gehen öfter aus und geben mehr Geld aus.
Sie waren in der Old Economy als Entwicklungsingenieur für Mercedes Benz tätig. Was würden Sie in dem Unternehmen ändern, wenn sie wieder zurück wechseln müssten?
Das besondere an Uber ist, dass wir lokal unterwegs sind. Das unterscheidet uns von anderen Internet-Unternehmen, die zentral organisiert sind. Wir haben in jeder Stadt, in der wir aktiv sind, ein eigenes Team und eine eigene Organisation. Das ist wichtig, weil das Team vor Ort das Geschäft als „ihr Baby“ betrachtet. Lokale Expertise und Identifikation mit der Stadt sind wichtige Erfolgsfaktoren von Uber. Genau diesen Ansatz würde ich auch bei größeren Firmen zur Anwendung bringen. Bereiche eingrenzen und Personen hundertprozentige Verantwortlichkeiten geben – weil es unglaublich motivierend ist.
Vermutlich ist diese lokale Ausrichtung bei Uber nicht zuletzt so wichtig, weil Sie es weltweit mit sehr unterschiedlichen politischen Rahmenbedingung und lokalen Playern zu tun haben. Stadt- und Verkehrspolitik ist ja etwas sehr Lokales und auch Emotionales. Wie sehen Ihre Erfahrungen mit Rot-Grün in Wien aus?
Die Voraussetzungen sind tatsächlich überall anders. Das sieht man daran, dass wir etwa auch in den USA einen etwas anderen Ansatz als in Europa verfolgen. Dort gibt es regulated ride sharing. Private Personen können, nachdem sie relativ einfache Voraussetzungen erfüllen, andere Menschen von A nach B bringen.
Und das geht hier nicht?
Nein, hier arbeiten wir ausschließlich mit lizenzierten Mietwagenunternehmern zusammen. Die Systeme sind also unterschiedlich in den diversen Märkten, die wir bedienen.
Und die Zusammenarbeit mit der lokalen Politik?
Wir führen hier sehr gute Gespräche auf allen Ebenen. Es geht zunächst darum zu informieren und zu erklären, welche Vorteile Uber für Nutzer, Fahrer und Städte bringen kann. Dabei geht es um die Lösung von Verkehrsproblemen, die Reduktion von Emissionen und das Schaffen von Arbeitsplätzen.
Woran liegt es aber, dass es in manchen Städten wie Paris große Aufstände und Demonstrationen gegen Uber gibt?
Ich glaube, wenn ein neuer Player in einer Branche auftaucht, in der sich jahrzehntelang nichts getan hat, schlägt das Wellen. Und Frankreich hat einfach eine Kultur, stärker zu demonstrieren. Die Art zu reagieren, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Umso wichtiger ist unser lokaler Ansatz.
Wer Personen von A nach B bringen kann, schafft das bestimmt auch mit Waren. Wo soll denn die Reise hingehen?
Ich denke, dass wir zunächst sicher noch im Bereich des Personenverkehrs besser werden können. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wir arbeiten zum Beispiel an UberEATS. Das ist ein Lieferservice für Essen, den wir in großen Teilen der Welt schon vorgestellt haben und der nun auch nach Europa kommt. Wir wollen diesen Service bis Ende des Jahres auch in Wien anbieten. Wir haben bis zu acht Stellen in Wien ausgeschrieben, denn wir wollen hier lokal wachsen und die Wirtschaft ankurbeln.
Nicht nur bei Ihnen liegen die Hoffnungen darauf, das schwächelnde Business dank digitaler Lösungen anzukurbeln. Wie sieht Ihre Einschätzung aus: Sind sich die österreichischen Unternehmer bewusst, welche Möglichkeiten, aber auch Risiken die Digitalisierung beinhaltet?
Ich glaube, es gibt manche, die sich bewusst sind, viele aber auch nicht. Man muss immer unterscheiden, wie man sowohl seine Produkte als auch seine internen Prozesse durch die Digitalisierung verbessern kann. Für beides gilt der Grundgedanke, dass man nicht nur analoge Prozesse digitalisieren, sondern dass man sie komplett neu denken sollte. Es geht darum, einen Schritt zurück zu machen, zu erkennen, dass man andere Möglichkeiten hat und zu hinterfragen, ob die Prozesse nicht völlig anders aussehen könnten. Es geht um das Bewusstsein – und darum, es auch umzusetzen.
Ein Learning, das Sie weitergeben können?
Man muss heute immer den Konsumenten in das Zentrum seiner Überlegungen stellen. Es geht um seine Bedürfnisse und nicht darum, was man selbst gerne verkaufen würde. Deshalb wurde auch Uber gegründet. Unser Gründer war in Paris und hat stundenland kein Taxi bekommen – dieses Problem wollte er lösen.
Was können sich Unternehmer in diesem Zusammenhang von Uber abschauen?
Eine Vision zu entwickeln und sie schnell zu realisieren. Den Ansatz, nicht nur das anzuschauen, was jetzt da ist und zu sondieren, wie man das Bestehende anders verteilen kann, sondern eine neue Perspektive einzunehmen. Wir wollen zum Beispiel, dass niemand mehr einen privaten Pkw nutzt. Wir wollen einen Mobilitätsmix, der aus Fahrradfahren, zu Fuß gehen, Uber, Taxi und Carsharing besteht. Die Leute sollen ihren eigenen Pkw aufgeben. Diese große Vision und ihre schnelle Umsetzung: Das ist es, was speziell ist an Uber.
Damit verfolgt Uber auch eine gesellschafts- und umweltpolitische Position. Ist das nötig, um erfolgreich zu sein?
Selbstverständlich. Darum bieten wir auch Services an, damit sich User, die in dieselbe Richtung wollen, ein Fahrzeug teilen können. Dadurch können wir mehr Leute mit weniger Autos transportieren. Das macht es gleichzeitig günstiger für die Nutzer. Und die Fahrer schaffen so eine höhere Auslastung. Wir tragen also zur Lösung von Verkehrsproblemen bei und schaffen gleichzeitig einen unmittelbaren Mehrwert für unsere Kunden. Das geht Hand in Hand.
Ein Ansatz, der bislang nur im zentralen Ballungsraum funktioniert. Was denken Sie: Wann kommen flächendeckende Lösungen?
Ich denke, wir werden bald an dem Punkt sein. In den USA können sich zum Beispiel schon 80 Prozent der Bevölkerung innerhalb von fünf Minuten ein Fahrzeug bestellen, und das gilt auch für den ländlichen Raum.
Wie funktioniert das?
Es ist in den USA gesetzlich vorgesehen, dass Privatpersonen, nachdem sie einige wenige Voraussetzungen erfüllen, Fahrten anbieten, also bezahltes Carsharing betreiben dürfen. Und das tun natürlich auch Leute tief im ländlichen Raum.
In Europa ist das schwieriger, weil die Zugangsvoraussetzungen zum Personentransportmarkt sehr hoch sind. Man muss eine Firma gründen, Fahrer anstellen und so weiter. Dafür braucht man natürlich auch eine hohe Auslastung, weil es sich sonst nicht rechnet. Das schafft man in Großstädten, aber im ländlichen Raum geht das nicht. Dort braucht man viele flexible Anbieter, die sich auf die Nachfrage einrichten können.
Und Sie sehen realistische Chancen, dass diese Restriktionen fallen?
Ich denke schon, ich bin zuversichtlich. Hier tut sich sehr viel. Auf der europäischen Ebene gibt es eine Agenda zur Sharing Economy, wo die EU den Mitgliedstaaten die Empfehlung gegeben hat, die Potenziale der Sharing Economy zu nutzen. In Estland, Litauen, und Portugal denken die Regierungen aktuell darüber nach, wie man die Zugangsbedingungen erleichtern kann.
Gibt es Länder, wo Uber bislang überhaupt nicht Fuß fassen konnte?
Vor ein paar Jahren haben wir in Deutschland einen Dienst eingeführt, bei dem Privatpersonen Fahrten anbieten. Da wollten wir mit dem Kopf durch die Wand und haben nicht mit Politik und Behörden zusammengearbeitet. Da gab es dann mehrere Städte, die gesagt haben: nicht mit uns. Das war ein Fehler, aus dem wir gelernt haben. Jetzt sind wir immer in Zusammenarbeit mit der Politik, um zu sehen, wie man gemeinsam Mehrwert schaffen kann.
Wie verhindern Sie, dass Uber in ein paar Jahren selbst einer anderen Disruption zum Opfer fällt?
Die Fragen, die unseren CEO und Gründer Travis Kalanick nachts nicht schlafen lassen, sind, welche Technologie und welcher Anbieter unser Geschäftsmodell auf den Kopf stellen könnte. Und das ist doch bemerkenswert bei einer Firma, die es erst seit sechs Jahren gibt. Die als Paradedisruptor dargestellt wird. Bei uns gibt es die Fähigkeit, diesen Umstand zu akzeptieren und es dann selbst zu machen, bevor es jemand anderes tut. Wir haben also eine Einstellung, die auf Innovation ausgerichtet ist.
Was könnte es sein, das Uber überrollt?
Selbstfahrende Fahrzeuge sind ein großes Thema. Das wird kommen, ob in fünf, zehn oder 15 Jahren. Die Technologie kann sehr schnell da sein. Wie es mit den Regularien aussieht und wie schnell die Technologie vom Verbraucher angenommen wird, ist eine andere Frage. Wir sehen das ja auch jetzt mit Hybridtechnologie. Die gibt es seit Jahrzehnten, sie ist mittlerweile auch kosteneffizient und trotzdem kaum verbreitet. Man kann also nicht auf einmal einen Hebel umlegen.
Uber hat Millionen von registrierten Usern und weiß, wer wann von A nach B fährt. Gibt es Fantasien, diesen Datenschatz zu Geld zu machen?
Unser Geschäftsmodell ist es garantiert nicht, Nutzerdaten zu verkaufen oder für Marketingzwecke zu nutzen. Wir nutzen Daten ausschließlich anonymisiert und aggregiert, um die Effizienz unseres Systems zu erhöhen. Um zu verstehen, wo viel Nachfrage besteht, welches Fahrzeug am besten geschickt werden soll, wann man welchen Service einführen kann.
Das Erweiterungspotenzial um neue Dienste muss ja aber durchaus verlockend sein.
Das ist aber nicht, was wir wollen. Es entspricht nicht unserer Vision und unserem Geschäftsmodell. Wir wollen Leute, die von A nach B möchten, mit jenen zusammenbringen, die das anbieten. Wir arbeiten derzeit lediglich an UberEATS und UberRUSH, wo es um Bedarfsgüter und Pakete geht. Dorthin wollen wir uns entwickeln.
Wie soll Uber in Österreich in ein paar Jahren aussehen?
Die Optionen sind vielfältig, wir wollen das Team erweitern, das Angebot ausbauen und Uber auch in andere Städte Österreichs bringen. Da gibt es Raum nach oben.



