Wer soll das lesen?
Nachhaltigkeitsberichte sind nicht beliebt. Ihnen eilt der Ruf voraus, von niemandem gelesen zu werden. Oft werden sie als besseres Marketinginstrument missbraucht. Schade, steckt doch in einem guten Bericht wesentlich mehr.

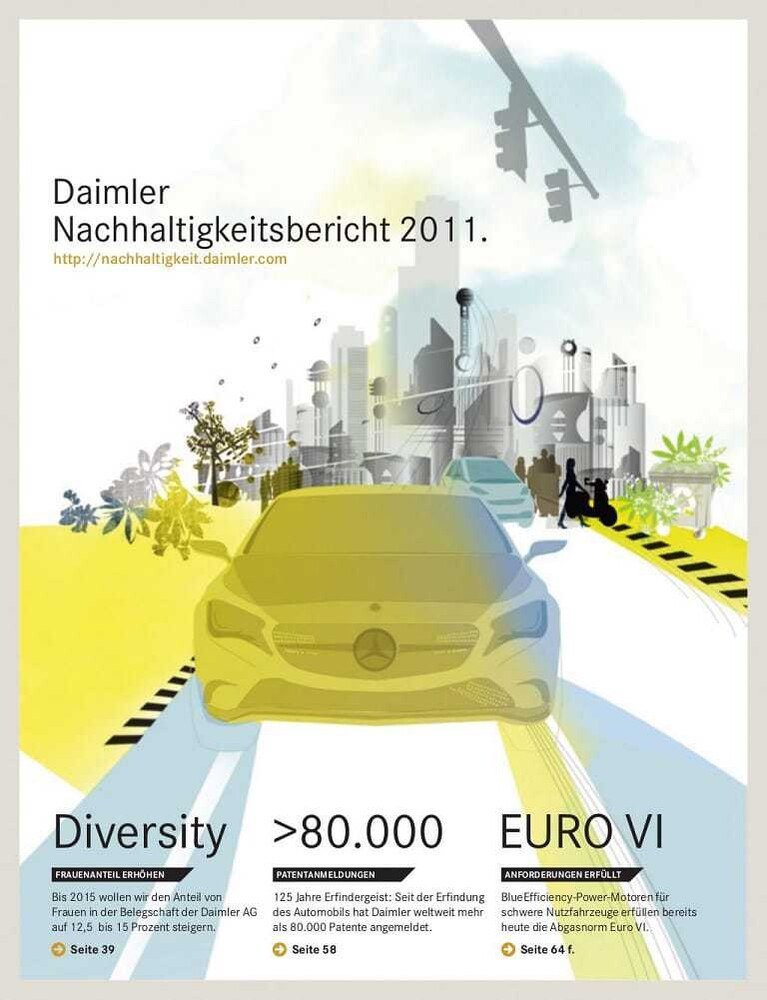
Seit 2018 müssen große, börsennotierte Unternehmen nach dem Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) berichten. Das NaDiVeG verlangt Angaben über Strategien und Konzepte zu Ökologie, Gesellschaft und Diversität. Österreich hinkt laut einer aktuellen Studie von KPMG zum Reporting im internationalen Vergleich hinterher. Sowohl bei der Anzahl der Berichte als auch beim Reporting über die Megatrends in der internationalen Berichterstattung: finanzielle Risiken des Klimawandels, CO₂-Reduktion, Sustainable Development Goals und Menschenrechte.
WAS KENNZEICHNET EINEN NHB?
Herzstück eines seriösen Berichts ist eine ordentliche Wesentlichkeitsanalyse. Diese bezieht sich auf die Auswirkungen des Kerngeschäfts und verhindert dadurch, über Dinge zu reporten, die für das jeweilige Unternehmen nicht relevant sind. Berichtet eine Bank über ihre – durchaus begrüßenswerte – Dach-Solaranlage, erfüllt sie die Vorgabe der Wesentlichkeit nicht. Erläutert sie dagegen das Ziel, die Spekulation auf Nahrungsmittel in drei Jahren um 50 % zu senken, ist sie nahe am Kerngeschäft und an den Interessen der Stakeholder. Hinzu kommen die entsprechenden Konzepte, wie mit den wesentlichen Themen verfahren wird samt Zielen und Kennzahlen. Dabei gilt: Der Weg ist das Ziel!
WAS KANN EIN NHB?
Nachhaltigkeitsberichte sind nicht nur für große Unternehmen interessant. Umfang und Ausführung können hier einen Unterschied machen. Für alle Unternehmen aber gilt: Werden die Chancen, die in der Analyse der wesentlichen Themen verborgen sind, erkannt und genutzt, profitieren sowohl Firma als auch Stakeholder.
Risiken, die bis dahin noch nicht als solche erkannt wurden, zeigen sich. Maßnahmen, die Ressourcen, Produkte oder Dienstleitungen und Kunden betreffen, lassen sich ableiten und strategisch erfassen, Innovationen werden generiert. Und vielleicht das Wichtigste: Stakeholderbeziehungen lassen sich verbessern! In Zeiten, da das Finden von Nachwuchs für viele ein echtes Problem darstellt, ist dies ein großer Treiber.
ZIELGRUPPE KONSUMENTEN?
Überlegt man, wie viel Arbeit, Aufwand und Geld mit der Berichterstellung verbunden ist, wundert man sich über das weitverbreitete „Das liest ja eh niemand!“.
Warum eigentlich kommunizieren Unternehmen zielgruppenrelevante Teile ihrer Nachhaltigkeitsberichte nicht direkt an die Konsumenten? Wer sagt, dass Mütter, die Babysachen kaufen, nicht daran interessiert sind, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei ihrer präferierten Marke gelebt wird? Es lohnt sich jedenfalls, zu Beginn des Berichterstattungsprozesses einige Fragen zu klären: Für wen ist der Bericht gedacht? Ist man zur Offenlegung verpflichtet? Fordern die Kunden Informationen ein? Will man das eigene Employer Branding unterstützen? Die Antworten werden nicht nur die Auswahl des geeigneten Rahmenwerks erleichtern, sondern auch die Priorisierung der Themen. So wird der Bericht zu einem sinnvollen und nützlichen Investment!
Zur Autorin:
ALEXANDRA ADLER. Geschäftsführerin von WEITSICHT – büro für zukunftsfähige wirtschaft. Wiener Landessprecherin der Expertsgroup CSR-Consultants der Fachgruppe Ubit. a.adler@weitsicht.solutions www.weitsicht.solutions



