Das Ende des Kapitalismus
Die Klima- und die Covid-Krise haben das Unbehagen gegenüber dem kapitalistischen Wirtschaftssystem verstärkt. Die Marktwirtschaft ist zwar, so glauben viele Wissenschaftler, das beste System, das wir kennen, doch sie muss sich selbst schöpferisch zerstören, um uns in der Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen. Eine Analyse der Optionen.

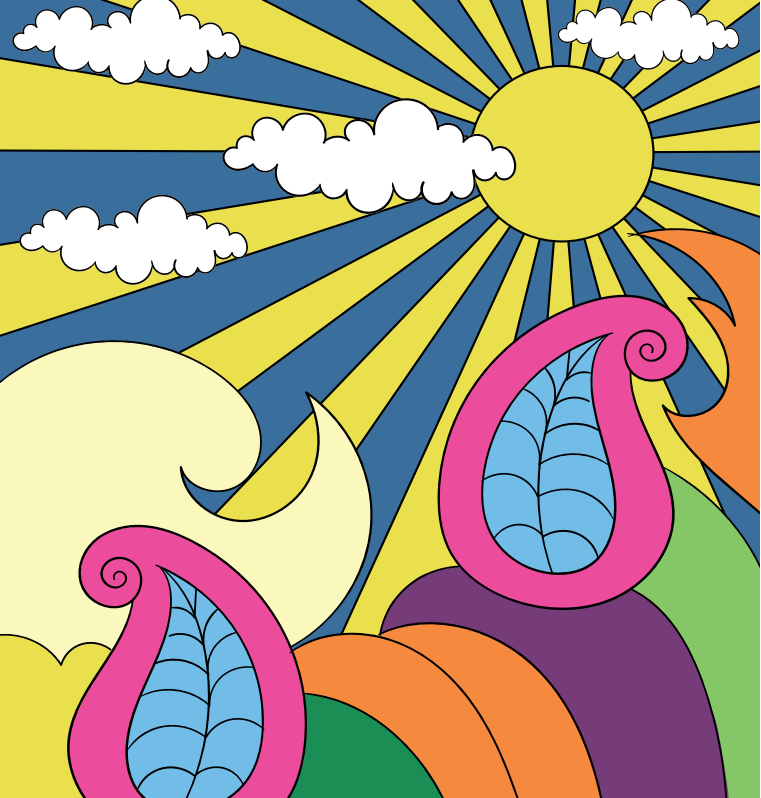


Hans-Dietrich Reckhaus will kein Mottenpapier und keinen Ungezieferspray mehr verkaufen. Dabei verdient der deutsche Unternehmer in zweiter Generation mit Insektiziden gutes Geld. Anstatt die Umsätze weiter in die Höhe zu treiben, druckt er den Hinweis „Dieses Produkt tötet wertvolle Insekten“ groß auf die Packungen. Reckhaus verfolgt seit 2015 ein klares Ziel, wie er dem Spiegel verriet: „Ich will den Markt kaputt machen.“ Ginge es nach ihm, würde er „sofort aufhören mit der Produktion von Insektiziden. Aber dann stünden meine Mitarbeiter auf der Straße, und ich würde einen Hebel verlieren, um mein eigentliches Ziel zu erreichen: eine neue Ethik“. Die Konkurrenz würde weitermachen und er als Aktivist nicht mehr wahrgenommen werden. Aus einem Wachstumsdenken heraus wirkt Reckhaus verrückt: Seit 2015 ist der Umsatz um ein Viertel, die Rendite um drei Viertel zurückgegangen. Doch er will sein Unternehmen schöpferisch zerstören. Der Begriff des Ökonomen Joseph Schumpeter bedeutet, etwas Altes zu zerstören, um etwas Neues zu schaffen. Und so soll Reckhaus’ Unternehmen zu einer Firma werden, die brachliegende Flächen und Firmendächer in insektenfreundliche Wiesen verwandelt und zwar ohne Arbeitsplätze zu zerstören. Und all das, weil einem Unternehmer mehr an Biodiversität als an den eigenen Zahlen gelegen ist.
RUF NACH SYSTEMWECHSEL Immer mehr Menschen befallen Zweifel am kapitalistischen System. Spätestens die Covid-Krise hat klar gemacht: Es kann nicht weitergehen wie bisher. Wobei wir das schon wissen, seit der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel belegt ist. Die Stimmen, die nach einem Systemwechsel oder zumindest einem Kurswechsel innerhalb des Systems rufen, werden zahlreicher und lauter. Für René Schmidpeter, Inhaber des Dr.-JuergenMeyer-Stiftungslehrstuhls für Internationale Wirtschaftsethik und CSR an der CBS International Business School sowie Gründer der Managementberatung M3trix, ist die Corona-Krise die Generalprobe für noch größere Veränderungen. Schließlich würden uns der Klimawandel und erst recht der Verlust der Artenvielfalt zukünftig weit mehr abverlangen als die aktuelle Krise: „Schaffen wir es, diese Transformationsprozesse in einer Weise zu gestalten, dass wir die wirtschaftliche und gesellschaftliche Funktionsfähigkeit aufrechterhalten und gleichzeitig die Schwachen, die unter der Krise besonders leiden, mitnehmen?“ Die Corona-Krise beschleunige nachhaltige Prozesse, die sowieso stattgefunden hätten. Sie habe die Schwachstellen im gegenwärtigen Wirtschaftssystem deutlich gemacht, etwa bei weltweiten Lieferketten, den Zuständen in der Fleischindustrie oder im Massentourismus. Dass in der Vergangenheit nicht alles super lief, habe auch die Nullzinspolitik der Zentralbanken als Zeichen für wirtschaftlichen Abschwung gezeigt.
Finden wir in der Pandemie zu guten Lösungsansätzen, würde uns das auch helfen, den Klimawandel zu meistern, ist Schmidpeter überzeugt. Die Herausforderung durch den Klimawandel hält er für um den Faktor zehn größer als jene der Covid-Krise: „Der Meeresspiegel würde ansteigen, es gäbe massive Migrationsbewegungen und Dürren. Der Planet würde unbewohnbar werden.“ Und was wären nun Lösungsansätze? „Die Wirtschaft muss sich einem Zweck widmen, der sich an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen wie Gesundheit, Bildung und sozialen Kontakten orientiert.“ Konkret müsste aus seiner Sicht jeder Euro, den Staaten für die Bewältigung der Corona-Krise ausgeben, auf größere Aufgaben zur Bewältigung des Klimawandels und des Biodiversitätsverlustes einzahlen, also in zukunftsfähige Geschäftsmodelle und positives Unternehmertum fließen – nicht in die Rettung alter Geschäftsmodelle in der Luftfahrt- oder Automotive-Industrie, wenn diese zu wenig in Innovation und Nachhaltigkeit investieren. Mit zehn Milliarden, so Schmidpeter, hätte ein Staat zum Beispiel 100.000 Start-ups finanzieren können: „Davon würden wohl zehn Prozent überleben. Wenn jedes dieser Startups zehn bis 50 Arbeitsplätze schaffen würde, wären das 100.000 bis 500.000 neue Arbeitsplätze in Unternehmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen.“
KREISLAUFWIRTSCHAFT BIS SHARING ECONOMY Im Kapitalismus sieht Schmidpeter per se kein Problem. Es gehe darum, ihn neu zu definieren und mit neuen Werten aufzuladen: „Wenn es der Kapitalismus schafft, sich schöpferisch zu zerstören, wird er sich auch erneuern.“ Es zeichne den Kapitalismus aus, dass er sich selbst zerstören kann, so zum Beispiel Die Klima- und die Covid-Krise haben das Unbehagen gegenüber dem kapitalistischen Wirtschaftssystem verstärkt. Die Marktwirtschaft ist zwar, so glauben viele Wissenschaftler, das beste System, das wir kennen, doch sie muss sich selbst schöpferisch zerstören, um uns in der Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen. Eine Analyse der Optionen. Fotos: Markus Roessle, Eric Kruegl 8 die wirtschaft bei der Transformation von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Eine Lücke würde dabei nicht entstehen, denn regionale Kreislaufökonomie, digitale Geschäftsmodelle und Sharing Economy würden innovative Ideen an den Start bringen, die sehr schnell wachsen. Aber noch stünden dem oft die alten Geschäftsmodelle im Weg. Daher brauche es ein Umdenken. „Es geht um eine wirkliche Transformation des marktwirtschaftlichen Systems. Das Problem dabei ist nicht der Kapitalismus, sondern das alte Mindset, das Profitabilität und Nachhaltigkeit als Gegensatz sieht.“ Die Politik solle nicht zu viele Vorgaben machen, sondern Rahmenbedingungen für nachhaltiges Unternehmertum schaffen: „Mit einer Ökodiktatur wird der Wandel nicht gelingen, das wäre der Worst Case.“
Sarah Spiekermann, Leiterin des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der WU Wien, kritisiert einiges am aktuellen System, obwohl auch sie keine KapitalismusGegnerin ist. Sie plädiert dafür, dass in der Wirtschaft und auch in der Technik nicht Werte wie Geld, Effizienz und Gewinnmaximierung, sondern Zufriedenheit, Freundschaft und Wissen forciert werden. Positiv sieht sie den Mittelstand: „Gerade die KMU in Österreich haben sich immer schon am christlichsozialen marktwirtschaftlichen Modell orientiert. Das ist ein gesundes Verhalten, weswegen es Österreich so gut geht.“ Man dürfe die Unternehmer, die ihre Firmen seit Jahrzehnten langfristig ausrichten, nicht einer pauschalen Kapitalismuskritik aussetzen. Probleme entstünden, wenn sie sich externe Investoren ins Haus holen oder ihre Arbeit komplett durchdigitalisieren und entfremden.
„Superreiche darf es nicht geben.“ Sarah Spiekermann, WU Wien
FINANZMÄRKTE UND LOBBYISTEN ABSCHAFFEN Spiekermann lehnt „das Hardcore-Liberale“ ab: „Die Finanzmärkte sind ein Geschwür des Kapitalismus. Dieses muss man loswerden, auch wenn es sehr mächtig ist.“ Auch professioneller Lobbyismus müsse verboten werden: „Lobbyisten lullen Politiker so ein, dass es möglich ist, dass Mitarbeiter in Unternehmen wie Amazon unmenschliche Arbeit leisten müssen. Gesetzgebung muss im lobbyfreien Raum passieren.“ Tausende von Rechtsanwälten, die von Lobbyisten engagiert werden und jedes Gesetz nach Schlupflöchern durchsuchen oder schon im Entstehungsprozess für diese sorgen, würden ein krankes System in vielen Industriebereichen erhalten, und es käme zu keinen guten Gesetzen. Dass Menschen mit Unternehmen reich werden, ist für Spiekermann in Ordnung, aber: „Superreiche darf es nicht geben. Wir brauchen eine ordentliche Umverteilung.“ Ein einheitliches europäisches Steuersystem sei nötig. Auch befürwortet sie ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches es Menschen ermögliche, sich freiwillig und nicht wegen finanzieller Abhängigkeit und Zwang einer Arbeit zu widmen. Spiekermann fasst ihre Vision so zusammen: „Wenn wir eine gesunde soziale Marktwirtschaft haben, eine ausreichend große Staatsquote bei allen kritischen Infrastrukturen inklusive der IT-Infrastruktur, wenn wir einen guten Mix aus analog und digital in den Unternehmen haben, wenn wir eine gute menschlich-ethisch-spirituelle Bildung unserer Bürger haben, wenn wir Menschen es schaffen, uns von unseren digitalen Geräten unabhängig zu machen, dann ist es möglich, dass wir in einem semikapitalistischen System ohne Superreiche ein gutes Leben führen.“
KONTROLLE UND LENKUNG Auch für Christoph Badelt, Leiter des WIFO, ist Kapitalismus kein Gespenst, das wir loswerden müssen: „Für mich ist Kapitalismus das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Dieses System braucht viel Kontrolle, aber ich halte die Marktwirtschaft noch immer für die beste Wirtschaftsordnung, die wir erfunden haben.“ Neben Kontrolle brauche es Lenkung: „Wir müssen uns im Dreieck zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen bewegen und alle drei ernst nehmen. Dann entsteht eine soziale und ökologische Marktwirtschaft.“ Das heiße zum Beispiel, Umweltauswirkungen ins Wirtschaftssystem einzubeziehen und so Kostenwahrheit zu schaffen: „Der Klimawandel hat mit CO₂- und anderen TreibhausgasEmissionen zu tun, und die werden immer noch zu billig in die Atmosphäre gepufft.“ Die Lösung der Probleme am Arbeitsmarkt – von hoher Arbeitslosigkeit über Facharbeitermangel bis hin zu Menschen, die zu wenig qualifiziert sind, um mit den sich rapide ändernden Anforderungen am Arbeitsmarkt und der Digitalisierung mitzuhalten – ist für Badelt klar: „Es klingt fad, ist aber wahr: Bildung ist die Lösung.“ Obwohl das heute Konsens ist, sieht er noch viel zu wenige Konsequenzen. Viele der aktuellen Kündigungen sind für ihn keine Auswirkung der Krise: „Hinter den Kündigungen in den großen Industriebetrieben wie MAN stehen Strukturveränderungen, die ohnehin gekommen wären.“ Oft müssen bei Kündigungswellen Geringqualifizierte als erste gehen – und da heißt es anzusetzen und etwa auch in ältere Arbeitnehmer zu investieren. Das wirke gegen eine weitere Spaltung der Gesellschaft.
„Ich halte die Marktwirtschaft noch immer für die beste Wirtschaftsordnung.“ Christoph Badelt, WIFO
LANGSAME REAKTIVE WIRTSCHAFT Der Politikwissenschaftler Daniel Hausknost, Assistenzprofessor am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit an der WU Wien, befürchtet, dass der Druck, Arbeitsplätze und Konsumfreiheiten zu erhalten, zu groß ist, als dass eine radikale Umgestaltung des Wirtschaftssystems im Sinne einer politisch gesteuerten schöpferischen Zerstörung möglich wäre: „Während ökologische und soziale Systeme bröckeln, bröckelt die fossil getriebene Wirtschaft zu langsam und reaktiv.“ Fossile Rohstoffe seien immer noch Wachstumstreiber. „Erst wenn hier politisch ein Ende eingeläutet ist, ist die Wirtschaft gezwungen zu reagieren.“ Nachhaltige Praktiken und Technologien kommen „eher on top“ ins Spiel.
Radikale Änderungen seien nötig, doch langfristig kaum durchhaltbar, da in repräsentativen Demokratien notwendige, aber unangenehme Entscheidungen vermieden werden: „Stellen Sie sich vor, die Regierung setzt den Benzinpreis auf sechs Euro. Das würde sie keine zwei Wochen überleben.“ Daher glaubt Hausknost, dass es neue Entscheidungsmechanismen und eine radikale Demokratie brauche, auch, um mächtige Lobbys zu umgehen. Er verweist auf das von Präsident Macron eingeleitete Bürgerforum in Frankreich, wo zufällig ausgewählte Bürger mit Experten diskutierten: „Sie fanden zu ziemlich radikalen Maßnahmen. Selbst ein Verbot von Inlandsflügen, eine Klimasteuer und ein Werbeverbot für klimaschädliche Produkte hätten sie sich auferlegt.“ Das habe gezeigt, dass Menschen auch zu unangenehmen Entscheidungen bereit sein können, wenn – und das ist entscheidend – die Einschränkungen alle betreffen.
HOFFNUNGSTRÄGER KAPITALISMUS Kapitalismus sei zwar ein Kampfbegriff, sagt Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria. Gemeint sei damit aber eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung, die sich neben den Produktionsmitteln im Privateigentum dadurch auszeichne, dass Preise nicht verordnet werden, Vertragsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit herrsche. Dieses System sei weltweit und vor allem in ärmeren Ländern im Vormarsch: „Dort weiß man, dass es das einzige Wirtschaftssystem ist, das den Aufstieg aus der Armut ermöglicht. In unseren westlichen Wohlstandshochburgen steht die Marktwirtschaft in der Kritik, weil wir den Blick dafür verloren haben, wo unser Wohlstand entsteht.“ Keine Generation habe auf so hohem Wohlstandsniveau gelebt wie wir: „Deshalb wollen alle Menschen aus den ärmsten Teilen der Welt zu uns – und nicht nach Venezuela oder Nordkorea.“ Die CoronaKrise zeige, wie eine Welt ohne Wachstum aussehe, in der schwere Wohlstandsverluste entstehen. Zugleich habe die Umwelt durch gesunkene CO₂-Emissionen profitiert. Jetzt müssen laut Schellhorn Ökologie und Ökonomie vereint werden. Das sei nur durch neue Technologien möglich, und diese würden nirgends besser gefunden als in marktwirtschaftlichen Systemen: „Es ist also der Kapitalismus, auf dem unsere Hoffnung ruht.“
Die Tatsache, dass Staaten derzeit massiv in die Wirtschaft eingreifen, ist für Schellhorn kein Zeichen dafür, dass dies generell mehr passieren sollte: „Der Staat hat mit seinen Eingriffen diese Krise ausgelöst – dafür gab und gibt es gute Argumente, schließlich hat die Gesundheit Vorrang.“ Aber im vergangenen Jahrhundert habe es mehr als genug politische Lenkung gegeben: „Das Lenken der Wirtschaft durch die Politik endete stets im Desaster.“ Wo der Staat sinnvoll intervieren könne, sei in der Bildung, „indem allen Menschen möglichst gleiche Startchancen eingeräumt werden“. Auch die Digitalisierung, die das Problem von Fachkräftemangel und gering qualifiziertem Personal noch verschärfen werde, schafft erhöhte Anforderungen an das Bildungssystem: „Wir tun so, als wäre die Digitalisierung eine Naturkatastrophe, die uns die Jobs raubt. Stattdessen müssen wir sehen, welche Fülle an neuen Jobs entsteht.“ Auch um ein soziales Sicherheitsnetz und das weise Einsetzen von Steuern und Sozialbeiträgen solle der Staat sich kümmern. Doch Schellhorn betont: „Finanziert werden die umverteilten Gelder allesamt in der Marktwirtschaft.“ Es scheint, als gäbe es trotz allen Unmuts über das Wirtschaftssystem nur wenige Kritiker, die dem Kapitalismus den Tod wünschen. Der Glaube daran, dass das System schöpferisch zerstört werden kann, treibt im Moment viele Wissenschaftler und Unternehmer um. Jetzt fehlen vielleicht wirklich nur noch Bürger und Politik, damit – wenn schon nicht alle, dann doch die meisten Menschen – an einem Strang ziehen und unser Wirtschaftssystem in eine ökosoziale Marktwirtschaft verwandeln, wo Umwelt und Lebewesen auf dem aufsteigenden Ast sitzen.



